|
|
Ing. (grad.) W. Brettschneider
Ing. (grad.) E. Niebisch
Prof. Dr. Ing. G. Schnell |
|
Tonhöhenschwankungs-Meßgerät |
|
Wenn auch die folgende Bauanleitung relativ umfangreich ist,
dürfte sie doch für viele Hobby-Elektroniker interessant
sein. Das hier vorgestellte Gerät erlaubt die Messung von
Drift und Flutter bei Tonbandgeräten und Plattenspielern,
wobei zwischen linearer und nach DIN 45 507 bewerteter Anzeige
gewählt werden kann. |
|
Bei der Schallaufzeichnung und -wiedergäbe
läßt sich infolge der begrenzten Präzision des
mechanischen Antriebes kein völlig konstanter Vorschub
des Tonträgers erzielen. Kleine kurzzeitige Schwankungen
(Flutter) und häufig auch ein Unterschied der mittleren
Geschwindigkeiten (Drift) am Anfang und am Ende der Aufnahme
sind unvermeidlich [1, 2].
Die Norm 45 507 schlägt zur Messung der Gleichlaufschwankungen
ein Meßgerät vor, das folgendermaßen arbeitet:
Ein Pilotton von 3150 Hz (hier ist das Ohr am empfindlichsten)
wird abgespielt, wobei über einen Frequenzdiskriminator
die von der Gleichlaufschwankung herrührende Frequenzmodulation
erfaßt wird (Bild 1). |
|
 |
Bild 1. Der Zusammenhang
zwischen Geschwindigkeits- und Tonhöhenschwankungen ist
rein linear |
Wird diese Frequenzmodulation im Bereich von 0,2
Hz bis 300 Hz direkt zur Anzeige gebracht, so spricht man von
linearer bzw. umbewerteter Anzeige. Bild 2 zeigt den Frequenzgang
des Meßgerätes in Stellung "linear".
Will man berücksichtigen, daß das Ohr nicht für
alle Schwankungsfrequenzen gleich empfindlich ist, so muß
vor die Anzeige ein Bewertungsfilter geschaltet werden. Das
von der Norm vorgeschlagene Bewertungsdiagramm ist zusammen
mit dem Verlauf des Bewertungsfilters des Meßgerätes
ebenfalls aus Bild 2 ersichtlich. |
|
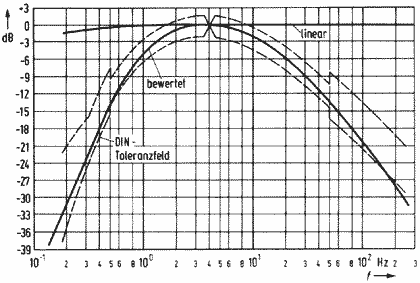 |
Bild 2. Durchlaßkurven
des Meßgeräts bei linearer und bewerteter Anzeige.
Als Vergleich ist das DIN-Toleranzfeld mit eingezeichnet |
Für Messungen an Plattenspielern muß
eine Meßschallplatte DIN 45 507 vorhanden sein. Tonbandgeräte
können entweder mit einem Tonband, auf dem der Normton
vorhanden ist (BASF), gemessen werden, oder es ist der Pilotton
mit dem zu prüfenden Gerät aufzunehmen und wieder
abzuspielen. Zu diesem Zweck besitzt das Meßgerät
einen eingebauten Quarzoszillator, der über Teiler 3150
Hz abgibt. Eine derartige Messung ist mehrere Male zu wiederholen,
es gilt der schlechteste Meßwert (DIN 45 511).
Gemäß der Norm wurde das Gerät so ausgelegt,
daß die Spitze-Spitze-Werte der schnellen Gleichlaufschwankungen
(Flutter) angezeigt werden. Bei der Drift wird die langsame
Abweichung von einer wählbaren Sollgeschwindigkeit erfaßt
und angezeigt.
So funktioniert die Messung
Bild 3 zeigt das Blockschaltbild, das wir kurz besprechen wollen. |
|
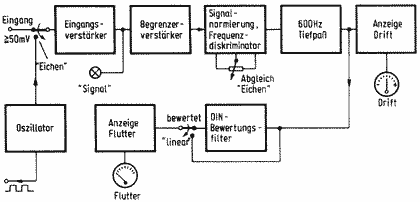 |
Bild 3. Blockschaltbild
des Meßgeräts |
Dem Eingangsverstärker wird über einen
Umschalter entweder das Meßsignal des Prüflings oder
das Eichsignal des internen Quarzoszillators zugeführt.
Das Meßgerät benötigt für eine einwandfreie
Messung ein Eingangssignal von mindestens 50 mV. Ob der Eingangspegel
groß genug ist oder nicht, wird durch eine Leuchtdiode
("Signal") angezeigt.
Mit dem verstärkten und durch einen Begrenzerverstärker
vorbereiteten Eingangssignal wird die Signalnormierungsstufe
geschaltet, die anschließend den Frequenzdiskriminator
ansteuert. Da dessen Ausgangsspannung für die Meßwertanzeige
zu klein ist, wird sie verstärkt und gleichzeitig mit aktiven
Tiefpässen von 3150-Hz-Resten befreit. Das resultierende
Signal wird nochmals von den einzelnen Meßverstärkern
für die "Flutter"- bzw. "Drift"-Anzeige
verstärkt und dann zur Anzeige gebracht. Bei der bewerteten
Messung der Tonhöhenschwankungen wird das nach DIN 45 507
geforderte Bewertungsfilter in den Signalzweig geschaltet, bei
linearer Messung wird es überbrückt.
Zur Erzeugung des Pilottones dient ein quarzstabilisierter Oszillator,
der auf 3,15 MHz schwingt und dessen Frequenz auf 3,15 kHz heruntergeteilt
wird.
Die vollständige Schaltung zeigt Bild 4. Sie enthält
auch das Netzteil für die Versorgungsspannungen -15 V,
+15 V und +5 V. |
|
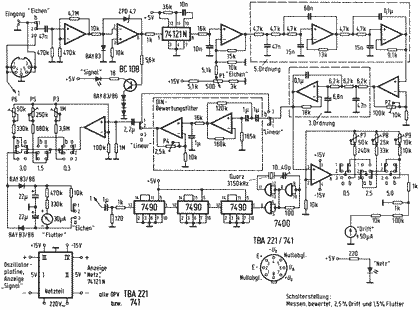 |
Bild 4. Die Flutter
und Drift-Meßschaltungen und die 3150-Hz-Erzeugung kommen
leider nicht ohne einige Abgleichpunkte aus |
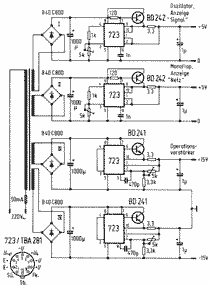 |
Bild 5. Die Schaltung
des Netzteils. Es liefert die vier hochkonstanten und kurzschlußfesten
Versorgungsspannungen |
Die neun Baugruppen
Der Eingangsverstärker
Der Eingangsverstärker ist als Elektrometerverstärker
aufgebaut, um das Meßobjekt nicht zu sehr zu belasten.
Die Verstärkung beträgt:

Der Eingang muß gleichspannungsmäßig entkoppelt
werden, da sonst bei einer dem Meßsignal überlagerten
Gleichspannung der Operationsverstärker übersteuert
werden könnte. Das Koppelglied 47 nF, 470 kOhm ist so dimensioniert,
daß der nach DIN 45 507 geforderte Eingangswiderstand
von 300 kOhm überschritten wird und die Grenzfrequenz weit
unterhalb von 3150 Hz liegt.
Der Begrenzerverstörker
Dem Eingangsverstärker ist ein Begrenzerverstärker
als Signalformer nachgeschaltet. Die Gegenkopplung erfolgt hierbei
durch eine 4,7-V-Z-Diode. Da der Verstärker das Eingangssignal
invertiert, muß der positive Teil des Eingangssignals
unterdrückt werden, damit am Ausgang eine positive Ausgangsspannung
ansteht. Dies geschieht durch die nach Masse geschaltete Diode
BAY 83. Die Spannung nach dem Begrenzer ist daher positiv, etwa
rechteckförmig und auf ca. 4 V begrenzt.
Außerdem wird vom Begrenzerverstärker eine Schaltstufe
angesteuert, die die "Signal"-LED ansteuert. Sie zeigt
dem Benutzer des Meßgerätes an, ob ein genügend
großes Eingangssignal anliegt.
Signalnormierung und Frequenzdiskriminator
Von der ansteigenden Flanke der Ausgangsspannung des Begrenzerverstärkers
wird das nachfolgende Monoflop 74 121, das zur Signalnormierung
verwendet wird, getriggert.
Das in seiner Amplitude konstante Ausgangssignal des Monoflops
von etwa 3,4 V wird an dem nachfolgenden RC-Glied aufintegriert.
Da sich, je nachdem, ob die Eingangsfrequenz höher oder
tiefer als die Pilotfrequenz ist, die Pausenzeit des Monoflops
ändert, wird der Kondensator mehr oder weniger aufgeladen.
Die Differenz der Kondensatorspannung zur Sollspannung bei der
Pilotfrequenz stellt das Meßwert-Nutzsignal dar.
Mit Hilfe des nachfolgenden Differenzverstärkers wird diejenige
Gleichspannung, welche am Kondensator bei der Pilotfrequenz
anliegt, kompensiert und das Träger- und Modulationssignal
ca. 5fach verstärkt. Die Kompensation auf Null erfolgt
mit dem Potentiometer P 1, das von außen einstellbar ist
("Eichen"). Der Abgleich erfolgt bei gedrückter
Eichtaste, so daß die intern erzeugte Frequenz von 3150
Hz am Eingang anliegt.
Das Tiefpaßfilter
Das Ausgangssignal des Frequenzdiskriminators muß auch
von Resten der Meßfrequenz (3150 Hz) befreit werden. Dies
geschieht durch zwei hintereinandergeschaltete aktive Tiefpässe
5. und 3. Ordnung [3], die durch einen Verstärker getrennt
sind. Dessen Verstärkung (P 2) kann zu Abgleichzwecken
l-...llfach eingestellt werden. Die eingestellte Verstärkung
ist etwa 6fach. Die Tiefpässe haben eine Butterworth-Charakteristik
und folgende gemessene Grenzfrequenzen:
5. Ordnung: ca. 780 Hz, Dämpfung ca. 88 dB/Dek.
3. Ordnung: ca. 620 Hz, Dämpfung ca. 55 dB/Dek.
Drift-Anzeige
Das Tiefpaß-Ausgangssignal wird nun direkt dem Meßverstärker
für die Drift-Anzeige zugeführt. Dieser ist galvanisch
gekoppelt, da auch Gleichspannungen angezeigt werden müssen.
Durch Tastendruck wird die Verstärkung für die drei
Meßbereiche 0,5 %, 2,5 % und 5 % geschaltet und der Meßwert
mit einem Drehspulinstrument ±50 µA zur Anzeige
gebracht. Der Nullpunkt des Drift-Instrumentes liegt in der
Mitte der Skala.
Das DIN-Bewertungsfilter
Bei bewerteter Flutter-Messung gelangt das Meßsignal über
das DIN-Bewertungsfilter zum Meßverstärker. Das Bewertungfilter
besteht aus einem Hochpaß und einem nachfolgenden Tiefpaß.
Mit dem Rückkopplungswiderstand P 4 (2,5 kOhm) kann die
Verstärkung dieses aktiven Tiefpasses so eingestellt werden,
daß die Dämpfung 0 dB bei 4 Hz beträgt. Bei
linearer (unbewerteter) Messung wird das Bewertungsfilter überbrückt
und das Meßsignal direkt dem Flutter-Meßverstärker
zugeführt.
Flutter-Anzeige
Die Ankopplung an den Meßverstärker erfolgt über
einen relativ großen Kondensator, da die untere Grenzfrequenz
kleiner als 0,2 Hz sein muß. Es können drei Meßbereiche
eingeschaltet werden: 0,3 %, 1,5 % und 3 %. Da der Spitze-Spitze-Wert
zur Anzeige gebracht werden soll, ist dem Meßverstärker
ein Greinacher-Gleichrichter nachgeschaltet, dessen Ausgangsspannung
von einem Drehspulinstrument mit einer Empfindlichkeit von 30
µA angezeigt wird. Die Begrenzung des Operationsverstärkers
dient somit zugleich als Überlastungsschutz für das
Meßinstrument.
Damit der Zeiger des Flutter-Anzeigeinstrumentes beim Drücken
der Taste "Eichen" schnell den Nullpunkt erreicht,
werden beim Drücken dieser Taste die Ladekondensatoren
über 10 kOhm entladen.
Der Quarz-Oszillator
Das Gerät enthält zur Erzeugung der nach DIN 45 507
vorgeschriebenen Meßfrequenz von 3150 Hz einen quarzstabilisierten
Oszillator, der auf 3,15 MHz schwingt [4]. Mit Hilfe eines Teilers
wird diese Frequenz auf 3150 Hz heruntergeteilt.
Im Rückkopplungszweig liegt dem Quarz ein Trimmkondensator
(10...40 pF) in Reihe. Er dient zur Feineinstellung der Oszillatorfrequenz.
Dem Ausgang des Frequenzteilers wurde noch ein Spannungsteiler
nachgeschaltet, der die Ausgangsspannung auf 0,4 V herunterteilt.
Dies ist zur Aussteuerung von Tonbandgeräten ausreichend,
der Ausgang ist dadurch kurzschlußfest. Ein Auskoppelkondensator
(1 µF, ungepolt) verhindert, daß unerwünschte
Gleichspannungsanteile vom Meßgerät auf den Eingang
des Prüflings gelangen können und umgekehrt.
Das Netzteil
Der Aufbau des Netzteils (Bild 5) wurde so konzipiert, daß
vier galvanisch getrennte Gleichspannungen zur Verfügung
stehen: 5 V, max. 400 mA, für Quarzoszillator, Frequenzteiler
und Signalanzeige; 5 V, max. 200 mA, für Monoflop und Netzanzeige;
und schließlich ±15 V, max. je 200 mA, für
die Operationsverstärker. Alle stabilisierten Spannungen
sind kurzschlußfest.
Der Aufbau
Alle Baugruppen wurden auf vier Europakarten (100 mm x 160 mm)
untergebracht. Die steckbare Filterplatine trägt die Funktionsgruppen
Eingangsverstärker, Begrenzer, Diskriminator, Tiefpaß
und Bewertungsfilter. Bild 6 zeigt die Platine, Bild 7 den zugehörigen
Bestückungsplan.
Die Anzeigeplatine trägt die beiden Anzeige Verstärker,
die Greinacherschaltung und die direkt eingelöteten Drucktastensätze.
Sie ist fest eingebaut. Die Platine selbst zeigt Bild 8 und
den Bestückungsplan Bild 9.
Die Oszillatorplatine ist steckbar. Sie ist in Bild 10 gezeigt,
den Bestückungsplan zeigt Bild 11. Das Netzteil ist auf
der vierten Platine untergebracht. Sie ist so ausgelegt, daß
auch der Netztransformator darauf Platz findet.
Die im Gerät verwendeten Spezialteile sind in der Tabelle
1 zusammengefaßt.
Tabelle 1
Im Gerät verwendete Spezialteile
| Drucktasten: |
2 Tastensätze mit je 3 Tasten, jede Taste
mit 2 x 3 Kontakten, gegenseitig verriegelt |
| Netztrafo: |
EI 60/21mm, 2x 21V, 2x9V |
| Gehäuse: |
300 mm x 200 mm x 130 mm
(Amtron, Remscheid) |
| 3150-kHz-Quarz |
(Wuttke-Quarze. 6000 Frankfurt 70, Hainerweg 271) |
| Kontaktleisten |
3 Buchsenleisten und 3 Steckerleisten DIN 41 617,
31polig |
|
|
|
| Bild 6.
Die Filterplatine |
Bild 7.
Bestückungsplan zur Filterplatine. Sie enthält
den Eingangsverstärker, den Begrenzer, den Diskriminator
und das Bewertungsfilter |
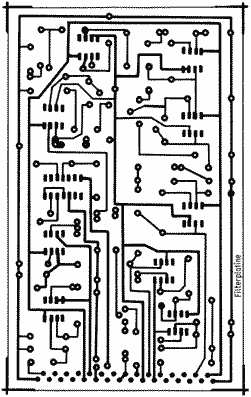 |
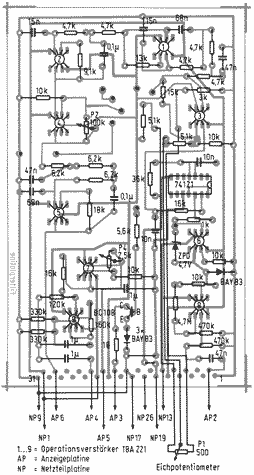 |
| |
|
| Bild 8.
Die Anzeigeplatine |
Bild 9.
Bestückungsplan zur Anzeigeplatine |
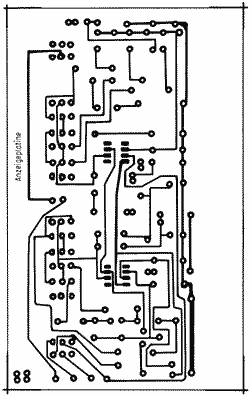 |
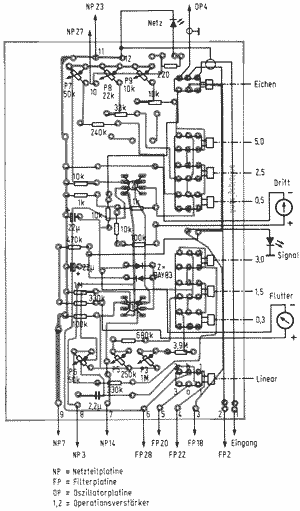 |
| |
|
| Bild 10.
Diese Platine enthält Oszillator und Teiler für
die Erzeugung von 3150 Hz |
Bild 11.
Bestückungsplan zu Bild 10 |
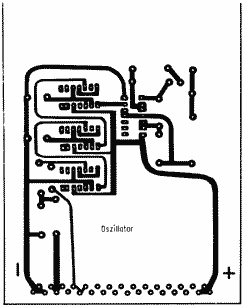 |
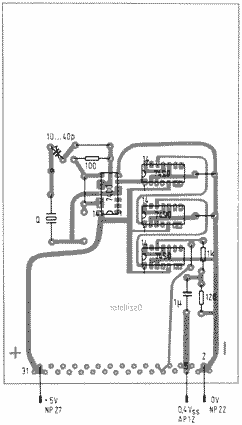 |
| |
|
| Bild 12.
Die Netzteilplatine liefert die vier stabilisierten Spannungen
für die Meßschaltungen. |
Bild 13.
Bestückungsplan zur Netzteilplatine |
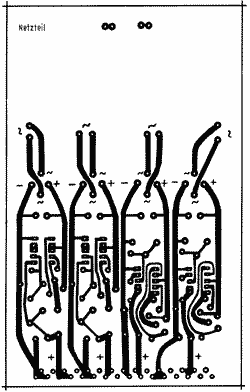 |
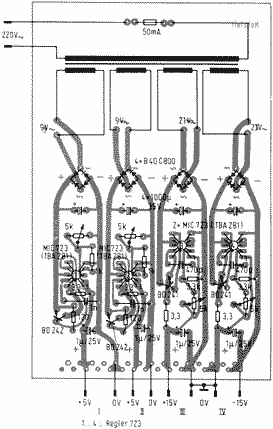 |
|
Der Abgleich
Der Abgleich des Gerätes ist leider nicht ganz problemlos.
Hat man ein handelsübliches Gleichlaufschwankungs-Meßgerät
zur Verfügung, so kann man dieses als Vergleichsnormal
heranziehen. Allerdings: Den Verfassern standen drei Vergleichsgeräte
zur Verfügung und keines zeigte dasselbe an wie die anderen
beiden! Sicherer ist deshalb der absolute Abgleich (Tabelle
2).
Mit einem langsamen Funktionsgenerator (f = 0,01 Hz bis 10 kHz,
z.B. hp 3310 A) steuert man den Wobbel-Eingang eines spannungsgesteuerten
zweiten Generators an (z. B. Wavetek 1800). Mit einer Gleichspannungsquelle
ist die Feineinstellung der Mittenfrequenz möglich. Mit
der Wobbelamplitude kann man eine Frequenzmodulation mit 4 Hz
von 3 %, 1,5 %, 0,3 % einstellen. Für die Drift-Anzeige
wird der Wobbel-Eingang nur über eine feineinstellbare
Gleichspannungsquelle angesteuert. Die Tabelle 2 zeigt (in der
Reihenfolge des Vorgehens) die jeweiligen Einstellpunkte.
Tabelle 2
(Reihenfolge des Abgleichs)
| Regler |
Platz |
Tastenstellung |
Abgleioh |
P1
(500 Ohm) |
Frontplatte |
Eich-Taste gedrückt,
Drift ±0.5 % |
Drift auf 0 |
P2
(100kOhm) |
Filterplatine |
Eich-Taste nicht gedrückt,
linear, Flutter 0,3 % |
Grobeinstellung Flutter Vollausschlag |
P3
(1 MOhm) |
Anzeigeplatine |
Eich-Taste nicht gedrückt,
linear, Flutter 0.3 % |
Flutter Vollausschlag |
P4
(2,5 kOhm) |
Filterplatine |
Eich-Taste nicht gedrückt,
bewert., Flutter 0.3 % |
Flutter Vollausschlag bei 4 Hz |
P5
(250 kOhm) |
Anzeigeplatine |
Eich-Taste nicht gedrückt,
linear, Flutter 1,5 % |
Flutter Vollausschlag |
P6
(50 kOhm) |
Anzeigeplatine |
Eich-Taste nicht gedrückt,
linear, Flutter 3 % |
Flutter Vollausschlag |
P1
(500 Ohm) |
Frontplatte |
Eich-Taste gedrückt,
Drift ±0,5 % |
Drift auf 0 |
P7
(50 kOhm) |
Anzeigeplatine |
Eich-Taste nicht gedrückt,
Drift ±0,5 % |
Drift Vollausschlag |
P8
(22 kOhm) |
Anzeigeplatine |
Eich-Taste nicht gedrückt,
Drift ±2,5 % |
Drift Vollausschlag |
P9
(10kOhm) |
Anzeigeplatine |
Eich-Taste nicht gedrückt,
Drift ±5 % |
Drift Vollausschlag |
|
Die Arbeit wurde im Labor für elektrische Meßtechnik
der Fachhochschule Frankfurt/Main ausgeführt. Die Autoren
bedanken sich bei den Herren Gerber, Pons und Oehler vom Hessischen
Rundfunk für die Unterstützung bei Vergleichsmessungen.
|
|
Literatur
| [1] |
DIN-Vorschriften 45 507 und 45 511. |
| [2] |
Christian, E.: Normgemäße Meßverfahren
der Magnettontechnik. FUNKSCHAU 1976, H. 11, 12, 13. |
| [3] |
Vahldiek, H.: Aktive RC-Filter, München 1972. |
| [4] |
Wuttke: Quarz-1 x 1 und Oszillatorschaltungen. Frankfurt/M.,
Hainerweg 271. |
| [5] |
Müller, O.: Einfaches Tonhöhenschwankungsmeßgerät.
FUNKSCHAU 1974, Heft 1. |
|
|
Ing. (grad.) Wolfgang
Brettschneider (26), Starkstromelektriker-Lehre, Nachrichtentechnik-Studium
an der Fachhochschule Frankfurt, seit 1976 bei der Bosch-Fernseh-GmbH
tätig.
Ing. (grad.) Erich Niebisch
(27), Radio- und Fernsehtechniker-Lehre, 1973 Abschluß
als staatl. gepr. Elektroniktechniker, Nachrichtentechnik-Studium
an der Fachhochschule Frankfurt, seit 1977 bei der Deutschen
Bundespost.
Prof. Dr. Ing. G. Schnell
(38), 6 Jahre wissenschaftlicher Mitarbeiter derTH Stuttgart,
4 Jahre Stabsmitglied bei Cern, Genf, seit 1973 an der Fachhochschule
Frankfurt, Bereiche Meßtechnik und Elektronik.
|
|
aus: Funkschau 23/1977, Seite
1099ff. und Funkschau 24/1977, Seite 1141ff.
Herzlichen Dank an die
Funkschau für die Erlaubnis, diesen Artikel hier zu
veröffentlichen. |
|
|