|
|
Aussteuerungsprobleme |
|
Alle Komponenten einer HiFi- Anlage müssen optimal ausgesteuert
sein. Damit wird gewährleistet, daß das zu verarbeitende
Programmaterial (Musik, Sprache, Geräusche) mit möglichst
geringem Qualitätsverlust "verarbeitet" wird.
Qualitätseinbußen treten auf sowohl bei zu hoher
Aussteuerung durch Klangverfälschungen infolge deutlich
erhöhter Verzerrungen (Klirrgrad und Intermodulation) als
auch bei zu schwacher Aussteuerung durch ein zu starkes und
damit auffälliges Störgeräusch (Rauschen und
Brummen). Der Lautstärkebereich zwischen der Verzerrungsgrenze
(sehr laut) und den Störgeräuschen (sehr leise) stellt
den übertragbaren Dynamikumfang dar (Bild 1: eingeschlossene
Fläche). |
|
 |
1 Dynamikbereich eines Tonbandgerätes, hier
eines guten Cassettenrecorders mit Cr- Band (II)
und Dolby-B.
- Oben: Verzerrungsgrenzen. Absolutes Maximum für
Signalbegrenzung bzw. Sättigung; höhere
Pegel können nicht mehr gespeichert werden.
Die mittlere Kurve entspricht üblichen Meßwerten
(Baß: 5% k3; Mitten: 3% k3; Höhen: Sättigung).
Kaum mehr wahrnehmbare Verzerrungen treten bei der
unteren Pegellinie auf. Bei länger andauernden
Tönen sollte sie möglichst nicht überschritten
werden (Tiefbaß: 3% k3; Mitten: 1% k3; Höhen:
2,5 dB unter Sättigung).
- Unten: Störspannungsgrenzen. Die Störspannung
setzt sich aus Brummanteilen (50 Hz und Harmonischen)
und Rauschen zusammen. Die Geräuschspannung
faßt den oberen Mitten- und den unteren Hochtonbereich
zusammen, die Fremdspannung bewertet den gesamten
Hörbereich gleichermaßen (wobei hier
die Brummanteile dominieren).
- Eingeschlossene Fläche: Gesamtdynamik. Die
verschiedenen Dynamikmeßgrößen
sind eingetragen: Fremdspannungsabstand, Ruhegeräuschspannungsabstand.
Höhendynamik und Tiefendynamik. (Die Tiefendynamik
wird von uns nicht bestimmt, da der Baßfrequenzgang-
insbesondere singuläre Welligkeiten- das Ergebnis
unzulässig verzerren. Die Tiefendynamik liegt
bei richtigem Baßfrequenzgang ca. 2, 5 dB
unter dem Fremdspannungsabstand. )
- Mitte: Pegelniveau für Frequenzgangmessungen
zur Orientierung (Pegel nach DIN festgelegt). |
|
|
Die "vorfabrizierten" Programme von Rundfunk und Schallplatte
bereiten keine Probleme. Verstärker und Empfänger
bzw. Schallplattenspieler sind aufeinander abgestimmt und weisen
jeweils ausreichende Dynamikreserven auf. Anders ist es bei
der Aufnahme auf Band (Spule oder Cassette). Es steht nur ein
beschränkter Dynamikumfang zur Verfügung, der deshalb
optimal genutzt werden muß. Zweispurgeräte- zumal
wenn sie mit einem Dolby- Rauschverminderungssystem ausgestattet
sind- lassen einen vergleichsweise weiten Aussteuerungsspielraum
zu, während Cassettenrecorder (mit Dolby) und übliche
Vierspurgeräte besonders kritisch sind.
Letzten Endes liegt es also in der Hand des Bedienenden, ob
er durch geschicktes Aussteuern die gegebenen Daten des Tonbandgerätes
voll ausnutzt. Einem geübten Hobby- Tonmeister gelingen
auf einem 800- DM- Recorder oft bessere Aufnahmen als jemandem,
der so nebenbei mal etwas auf seiner kostspieligen Tonbandmaschine
aufzeichnet.
Aussteuerungshilfen
Nun kann aber die Aussteuerung nicht allein dem Geschick einiger
eingeweihter Kreise obliegen. Gute HiFi-Tonbandgeräte sollten
so ausgelegt sein, daß auch Laien ohne Mühe gut ausgesteuerte
Aufnahmen machen können.
Das Wichtigste ist die Vermeidung von Übersteuerungen (Bild
1: obere Kurven), da diese am stärksten zu einer Klangverfälschung
beitragen. Die Aussteuerungsanzeigen müssen daher signalisieren,
wann die Verzerrungsgrenze des Bandes überschritten wird.
Neben der Anzeige dieser absoluten Aussteuerungsgrenze ist natürlich
eine Vorwarnung notwendig, so daß die momentan vorhandenen
Sicherheitsreserven abgelesen werden können. Aussteuerungsanzeigen
weisen daher eine Skala auf, die von mittellaut (-20 dB) bis
laut (0 dB) -zur Übersteuerungsgrenze- und darüber
hinaus noch weiter in den roten Bereich (bis +3 dB) reicht.
Dieser "unerlaubte" Bereich darf nur in extremen Fällen
und nur kurzzeitig ausgenutzt werden, weil sonst die Verzerrungen
deutlich hörbar werden.
Spitzenwertanzeigen
Der höchste überhaupt auftretende Spannungs- bzw.
Lautstärkewert ist für die Größe der Verzerrungen
ausschlaggebend. Dieser Spitzenwert sollte also angezeigt werden.
Dabei ist es keinesfalls wichtig, daß die Anzeige selbst
trägheitslos schnell arbeiten kann, wie z. B. Leuchtdioden.
Verantwortlich für die Arbeitsweise der Anzeigen ist die
sich dahinter versteckende Elektronik, das heißt der Gleichrichterkreis.
Dieser kann nur dann, wenn er geeignet ausgelegt ist, den Spitzenwert
eines Signals verarbeiten. Und dies muß, da die Töne
in der Musik ja oft nur ganz kurz erklingen, sehr schnell geschehen.
Der oft nur 3 ms (entsprechend 3/1000 Sekunden) lang auftretende
Spitzenwert wird dabei so lange gespeichert (ca. 200 ms), bis
auch ein verhältnismäßig träger Zeiger
auf den entsprechenden Wert ausschlagen kann oder eine Leuchtdiodenanzeige
für das Auge gut wahrnehmbar wird.
Bewertende Anzeigen
Darüber hinaus muß eine Aussteuerungsanzeige berücksichtigen,
ob das Magnetband bei allen Frequenzen gleich stark ausgesteuert
werden kann oder nicht. Oft dürfen Magnetbänder nämlich
bei tiefen Tönen nicht ganz so hoch und bei hohen Tönen
sogar nur deutlich schwächer ausgesteuert werden. Im Hochtonbereich
ist dies abhängig von der Bandgeschwindigkeit und der Bandsorte.
So ist ein Magnetband mit Chromdioxidbeschichtung bzw. mit einem
besonders hochwertigen Eisenoxid einem normalen Band deutlich
überlegen. Andererseits kann bei der hohen Bandgeschwindigkeit
von 38 cm/s, wie sie in Studios verwendet wird, der Hochtonbereich
genauso stark ausgesteuert werden wie die mittleren und tiefen
Töne. Studioaussteuerungsanzeigen arbeiten deshalb frequenzlinear,
das heißt, sie bewerten alle Tonlagen gleich stark. Bei
Spulengeräten mit 9,5 cm/s und bei Cassettenrecordern wäre
diese Art von Anzeige aber von Nachteil. Es sind Anzeigen vorzuziehen,
die im Hochtonbereich besonders empfindlich ansprechen. Diese
können dann durch stärkeres Reagieren den früheren
Verzerrungseinsatz bei hohen Tönen wirklich anzeigen. Spitzenwertanzeigen
mit Höhenanhebung findet man aber leider nur in sehr wenigen
Bandgeräten.
VU- Meter
Hierzu im Gegensatz stehen VU- Meter. Bei Cassettentonbandgeräten
kann mit ihnen nur sehr unvollkommen die Übersteuerungsgrenze
festgestellt werden. Geräte mit VU-Metern übersteuern
oft schon bei einer so schwachen Anzeige wie -12 bis - 4 VU.
Gegenüber Spitzenwertanzeigen haben VU- Meter jedoch einen
Vorteil: sie zeigen Volume Units (zu deutsch: Lautstärkeeinheiten)
an. Mit ihnen können also die Lautstärkeverhältnisse
von Musikstück zu Musikstück oder auch zu einer Sprachaufnahme
besser abgestimmt werden. Auch erlauben sie weit exakter als
Spitzenwertanzeigen eine visuelle Kontrolle der Kanalbalance.
Sollen beide Forderungen, Übersteuerungsfreiheit und Lautstärkeabstimmung,
erfüllt werden, so muß man höhenbetonte Spitzenwertanzeigen
und frequenzlineare VU- Meter gleichzeitig verwenden.
Bei Aufnahmen von Schallplatte und Rundfunk wird schon ein Großteil
der Aussteuerung vorgefertigt. Die Stereobalance muß kaum
korrigiert werden. Verschiedene Schallplatten und Rundfunksendungen
bedürfen zudem nur einer geringfügig anderen Aussteuerung.
Besondere Anforderungen stellen dagegen eigene Mikrophonaufnahmen.
Kritische Klänge
Bei einigen Instrumenten ist ganz besondere Vorsicht geboten.
Z. B. erreicht ein Klavierton nach dem Anschlagen der Saite
nur ganz kurzzeitig eine extreme Lautstärke, die dann bis
zum Anschlagen des nächsten Tones abklingt. Und obwohl
die Lautstärkeempfindung gar nicht groß ist. werden
diese Lautstärkespitzen verzerrt wiedergegeben. Gleichzeitig
kann das Gehör zwischen den einzelnen Tönen Hintergrundrauschen
heraushören, zumal dann, wenn es nicht von begleitenden
Instrumenten verdeckt wird. Auch Zischlaute und metallische
Geräusche werden leicht übersteuert. Sie weisen einen
starken Hochtonanteil auf. Das gilt somit auch für das
Schlagzeug. Ähnlich ist es mit den heute immer häufiger
werdenden elektronisch verfremdeten oder rein elektronisch arbeitenden
Instrumenten. Insbesondere der Synthesizer kann mit seinem Obertonreichtum,
wie er von "natürlichen" Instrumenten kaum bekannt
ist, extreme Anforderungen stellen. Der behäbige Klang
mancher Kirchenorgeln dagegen stellt kaum Anforderungen an die
Aussteuerungsinstrumente. Ihr Klang ist obertonarm, die Töne
sprechen langsam an und klingen mit starkem Nachhall aus (vgl.
Bild 2)
|
|
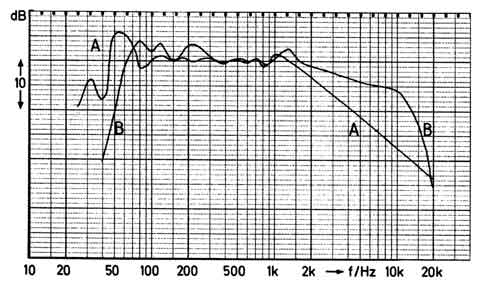 |
2 Zum Vergleich in gleicher Darstellungsart die
Spitzenlautstärken zweier Musikstücke
relativ zum mittleren Frequenzbereich (in Anlehnung
an HiFi- Jahrbuch 9, Seite 36:
A.: Orgelsymphonie von Camille Saint- Saens;
B.: Pleasant Valley Sunday mit James Last).
Musik A ist baßbetont. Musik B dagegen höhenintensiv.
Mit guten Aussteuerungsanzeigen kann in beiden Fällen
so ausgesteuert werden, daß bei allen Frequenzen
ein gewollter Sicherheitsabstand zu den Grenzkurven
eingehalten wird. |
|
|
| |
|
| Die praxisgerechte
Aussteuerung und ihre Bewertung |
|
| |
|
|
Die technischen Daten eines Tonbandgerätes sind nur
ein Hinweis darauf, welche Klangqualität bei optimaler
Aussteuerung möglich ist. Wie wichtig eine richtige Aussteuerung
sein kann, fiel uns besonders bei einem Cassettenrecorder-Hörvergleich
auf (-> HiFi-Stereophonie 4/77). Ein Gerät mit überdurchschnittlichen
Meßwerten schnitt sehr ungünstig ab. Dagegen belegte
ein Gerät des gleichen Typs, nachdem die Aussteuerungsanzeigen
von uns umgebaut worden waren, den zweiten Platz direkt hinter
unserer Laborreferenz. Eine numerische Bewertung der Aussteuerungseigenschaften
erscheint uns daher notwendig. Die beste Bewertung von 10
Punkten soll andeuten, daß die Aussteuerung sehr einfach
und bequem von jedem Laien vorgenommen werden kann und daß
zusätzlich auch dem engagierten Amateur alles Wichtige
geboten wird. Bei 0 Punkten oder sogar negativen Bewertungen
kann eine anspruchsvolle HiFi-Qualität -wenn überhaupt
- nur mit Fachkenntnissen und durch Überwindung von Bedienungsmängeln
erreicht werden. Üblicherweise führen deutliche
Übersteuerungen - insbesondere im Hochtonbereich - zu
solch schlechten Ergebnissen.
Bewertungskriterien
In unseren Tests werden die Aussteuerungsanzeigen von Spulen-
und Cassetten-Tonbandgeräten nach den folgenden Kriterien
bewertet:
- allgemeine für die Aussteuerung wichtige Eigenschaften
(z. B. gehörmäßige Kontrollmöglichkeit,
Bedienbarkeit);
- optische Eigenschaften (Ablesbarkeit);
- technische Eigenschaften (Elektronik);
- Aussteuerungseigenschaften über Band (Abstimmung
auf die Übertragungseigenschaften).
Und die Maxime der Auswertung: Jeder soll ohne Mühe
und ohne besondere Vorkenntnisse jede Art von Programmaterial
optimal verzerrungsfrei und rauscharm aufzeichnen können.
1. Aussteuerungspotentiometer
und Hörkontrolle
Wie oft ärgert man sich über schlechte Eingangspotentiometer,
besonders dann, wenn man wirklich am Gerät arbeitet,
also einblendet, die Stereobalance korrigiert oder verschiedene
Quellen mischt. Auch müssen Amateure oft bei Wiedergabe
die Aussteuerung ablesen können, und dies besonders bei
Testtönen (z. B. Dolbyreferenzpegel) möglichst genau.
Eine Vorhörmöglichkeit über die Aussteuerungssteiler
ist sicherlich sinnvoll. Noch besser ist allerdings eine echte
Hinterbandkontrollmöglichkeit. Diese wird daher auch
besonders hoch bewertet, und zwar in Verbindung mit guten
Kopfhörerverstärkern mit 2 Punkten. Bei Hinterbandkontrolle
können eklatante Aussteuerungsfehler hörbar werden,
allerdings erst bei laufender Aufnahme, dann aber sofort.
Der Bewertungsspielraum kann hier im (seltenen) Extremfall
-1,7 bis +5,3 Punkte betragen.
2. Lupe oder Taschenlampe
Was nützt aller technischer Schnickschnack, wenn die
Aussteuerung bei Dunkelheit oder bei Auflicht nicht abgelesen
werden kann, wenn ein Zeiger schlecht sichtbar ist, die Skalierung
verwirrt oder man aus anderen Gründen die Augen stark
anstrengen muß. Der Bewertungsspielraum kann hierbei
-0,7 bis +2 Punkte betragen.
3. Lautheit oder Übersteuerung
Eine ideale VU-Anzeige wird mit bis zu 2 Punkten honoriert,
eine ideale Spitzenwertanzeige mit bis zu 2,7 Punkten (technisch
aufwendiger als VU). Sind beide Anzeigearten vorhanden, addieren
sich die Punkte. Bei "nur" umschaltbaren Anzeigen
werden aber hiervon Abstriche gemacht. Auch kann eine einstufige
Spitzenwertanzeige (LED) bei weitem nicht so hoch bewertet
werden wie eine mehrstufige Anzeige, da die Vorwarnung entfällt.
4. Rauschend oder dumpf-verzerrt
Nur mit einer optimal abgestimmten Anzeige lassen sich die
Verzerrungsgrenzwerte optimal ausnutzen. Für die Anpassungsfähigkeit
der Anzeige an unterschiedlichste Klang-und Dynamikstrukturen
kann je nach den technischen Eigenschaften der Anzeige und
je nach Bandgeschwindigkeit ein Bonus von bis zu 1,3 Punkten
gegeben werden. Ansonsten hagelt es in diesem Prüfbereich
nur Minuspunkte (und leider oft genug recht zahlreich). (Man
wird dabei den Verdacht nicht los, daß für allzuviele
Konstrukteure nur Sinustöne existieren und daß
sie ihre Geräte nur für Hintergrundmusik einsetzen.
) Eine Übersteuerung mit Sinusdauerton (tritt sehr selten
auf) und/ oder mit unserem "Duo-Burst" (siehe getrennte
Erläuterungen zu diesem Meßsignal) wird negativ
bewertet. Ebenso kann aber auch eine viel zu starke Untersteuerung
(das bedeutet unnötig starkes Rauschen) Punkteabzug bedeuten.
Wir erwarten bei Dauerton eine Vollaussteuerung, die bei minimal
0,3 bis 0,5% Klirrgrad (-50 bis -46 dB) und bei maximal 3%
(-30,5 dB) liegen sollte. Bei unserem Duo-Burst darf der Spitzenpegel
für k3 = 3% nicht überschritten werden. Darüber
hinaus darf der Obertongehalt dieses Signals bei Vollaussteuerung
um nicht mehr als 3 dB abnehmen. Gerade bei dieser letztgenannten
Übersteuerungsart können 7 Punkte Abzug und mehr
durchaus möglich sein. Dieser Wert ist besonders stark
abhängig von der Bandgeschwindigkeit oder auch vom Bandtyp
(Fe oder Cr), so daß diese Hochtonübersteuerung
vor allem zu den unterschiedlichen Gesamtbewertungen der praxisgerechten
Aussteuerung bei demselben Gerat beiträgt. Bei einem
optimalen Gerät könnte die Spitzenbewertung von
10 Punkten sogar überschritten werden (12 Punkte!). Dieses
Optimum existiert derzeit aber lediglich auf dem Wunschzettel
eines HiFi-Tonbandamateurs.
Aussteuerungsautomatik?
Zur Zeit müssen Aussteuerungsautomatiken für hochwertige
HiFi-Aufnahmen aus folgenden Gründen abgelehnt werden.
- Durch die elektronische Pegeleinstellung werden nichtlineare
Verzerrungen (insbesondere Intermodulationen) erzeugt, oft
werden auch Regelimpulse in den Signalweg eingekoppelt (das
sind signalfremde zusätzliche Baßimpulse, die
bei einem Lautstärkesprung entstehen).
- Das optimale Aussteuerungsniveau wird nur selten richtig
bestimmt (das gleiche Problem wie bei Aussteuerungsanzeigen).
Zudem werden die Anfänge von Musikstücken in jedem
Fall stark verzerrt, bis die Automatik sich auf den richtigen
Aussteuerungswert eingestellt hat. Der Nachregelbereich
ist zu groß, so daß die Dynamik über ein
tolerierbares Maß hinaus eingeengt wird.
Vor kurzem wurden Meßreihen an preiswerten Noch-nicht-HiFi-
Cassettenrecordern mit Aufnahmeautomatik durchgeführt.
Die Ergebnisse waren erschreckend. Beachtenswert ist aber,
daß nur wenige Produzenten etwas mehr Aufwand in der
HiFi-Klasse treiben. Eine Bewertung der Aussteuerungsautomatik
entfällt in unseren HiFi-Tests aus den oben genannten
Gründen im Normalfall. Eine Ausnahme bilden Reportagegeräte.
Ein Limiter- also eine zur Handaussteuerung zusätzlich
wirksame „Notbremse" - ist dagegen prinzipiell durchaus
sinnvoll. Da jedoch auch hier die Schaltung zu oft sehr billig
ausgeführt wird und die Ansprechschwelle fast immer deutlich
zu hoch liegt, kann kaum ein Gerät einen Zusatzpunkt
erhalten.
|
|
| |
|
| Duo- Burst |
|
| |
|
|
Warum?
Wir möchten unsere Leser möglichst wenig mit praxisfremden
Daten belasten, das tun die Hersteller schon zur Genüge.
Die Angaben: "x % Klirrtaktor bei 0-dB-Anzeige"
oder "3% Klirrfaktor bei +y-dB-Anzeige" geben keine
praxisnahen Betriebsbedingungen wieder. Ja, es ist sogar häufig
so, daß gerade die Geräte, die in diesen zwei Punkten
gut erscheinen, bei Musik übersteuern. Wir geben diese
Werte daher nicht zahlenmäßig an. Wer sich aber
dennoch für diese Basisdaten interessiert, kann sie -
eingebettet in zusätzliche Informationen - aus unserem
Aussteuerungsdiagramm ablesen. Musik ist eben etwas anderes
als ein 333-Hz-Sinus.
Wie?
Man nehme eine 500-Hz-Rechteckschwingung (Bild 1; die Tonhöhe
entspricht dem h'). Diese wird zweifach zerhackt. Daher kommt
auch der Name "Burst" (englisch für Impuls,
Stoß). Beim ersten Zerhacken wird das Rechtecksignal
in vier Perioden "aus"- und in vier Perioden "eingeschaltet"
(nullpunktsynchron). Ein solcher Zyklus (vier aus, vier ein)
dauert 16 ms. Dieser Einfach-Burst (Bild 2) wird nun nochmals
geschaltet, und zwar einmalig für acht Zyklen ein. Er
dauert also 8 x (4 + 4) = 64 Perioden (Duo-Burst; Bild 3,
anderer Zeitmaßstab!). Dieses so gewonnene Signal zeichnet
sich durch drei wichtige definierte Eigenschaften aus:
- konstante Dauer: 128 ms ~ 1/8 s (oder für unsere
Musiker entsprechend einer 1/16 Note bei einem Taktmaß
von MM 1/4 Note entsprechend 120);
- konstanten Zusammenhang von Mittelwert (Gleichrichtwert),
Effektivwert (Leistungsinhalt) und Spitzenwert (Amplitude);
- konstantes, genau bekanntes Obertonspektrum.
|
|
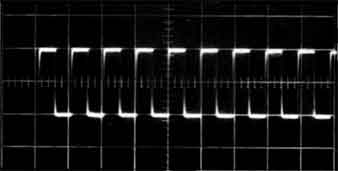 |
1
Rechtecksignal 500 Hz (Zeitmaßstab 2 ms/Skt) |
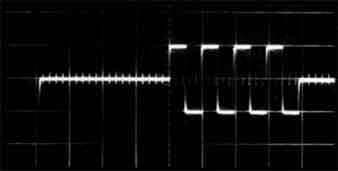 |
2a Einfach-Burst vier aus / vier ein (sonst wie 1) |
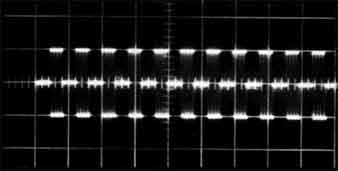 |
2b Wie 2a, jedoch Zeitmaßstab geändert (20 ms/Skt) |
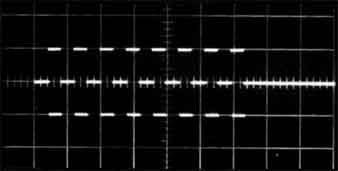 |
3 Duo-Burst: acht Zyklen des Einfach-Burst eingeschaltet (Zeitmaßstab
wie 2b) |
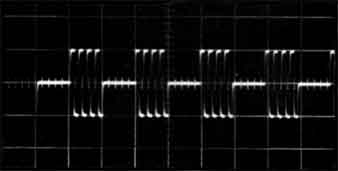 |
4 Wie 2a, jedoch Grundfrequenz auf 2 kHz umgeschaltet |
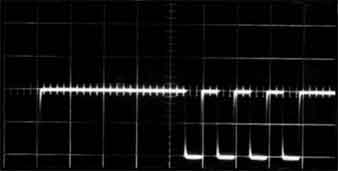 |
5
Wie 2a, jedoch Nullinie verschoben (hier: negative Impulse) |
Zu 1 und 2: Aufgrund der gewählten Impulsfolge
sprechen studiomäßige VU-Meter so an, daß sich
mit diesem Impuls ungefähr Vollaussteuerung ergibt (entsprechend
einem Anzeigevorlauf von knapp 8 dB). Der Duo-Burst entspricht
damit dynamisch einem Musiksignal, denn gerade aus der üblichen
Aufnahmepraxis heraus legte man den VU-Vorlauf im Mittel auf
8 dB fest.
Zu 3: Der Obertonanteil (siehe Spektralanalyse Bild 6) beträgt
für die 10-kHz-Terz -26 dB, bezogen auf den Gesamtpegel,
und -23,5 dB, bezogen auf den Pegel bei mittleren Frequenzen.
Für die Analyse des Obertongehaltes wird übrigens
nur der Einfach-Burst verwendet. Oberhalb 10 kHz wurde der Obertongehalt
bewußt eingeschränkt (10-kHz-Tiefpaßfiiter
6 dB/Oktave). Der Obertongehalt entspricht durchschnittlichen
Werten. Das geht auch daraus hervor, daß die UKW-Hochtonquaiität
ausreicht, dieses Testsignal mit zufriedenstellenden bis sehr
guten Ergebnissen zu übertragen.
Wozu?
Analyse der Aussteuerungsanzeigen
Während des zweifachen Zerhackprozesses des Rechtecksignals
bleibt die Amplitude des Signals unverändert. Diese Tatsache
wird bei der Analyse ausgenutzt. Die unterschiedliche Reaktion
der Aussteuerungsanzeigen bei dem kontinuierlichen Rechtecksignal
und dem Einfach-Burst gestattet es, Rückschlüsse zu
ziehen auf die Bewertung der Signalfeinstruktur (Spitzenwert-
bis Mittelwertanzeige). Beim Duo-Burst kommt die unterschiedliche
Ansprache auf die Signalgrobstruktur hinzu (Anstiegszeit, sehr
schnell bis träge). Auch die Rücklaufzeit nach dem
einmaligen Impuls ist wichtig für den Zusammenhang zwischen
Aussteuerungsanzeige und Lautstärkeeindruck. Für weitere
Analysen kann der Duo-Burst-Generator aber auch auf eine Grundfrequenz
von 2 kHz (h'") umgeschaltet werden (Bild 4). Der Obertonanteil
nimmt um 6 dB zu, die Impulszeiten betragen nur noch ein Viertel.
Dies simuliert den extremen Fall von Musik mit besonders ausgeprägten
Lautstärkespitzen und ungewöhnlichem Hochtonreichtum.
Auch kann die Signalsymmetrie zur Nullinie verändert werden
(Bild 5), um die unterschiedliche Ansprache der Gleichrichter
auf die zwei Halbwellen einer Wechselspannung zu untersuchen
(Umpolfehler). Das ist wichtig für Spezialfälle, wie
z. B. die Aufnahmen synthetischer Musik. Elektronische Orgeln
und Synthesizer erzeugen oft unsymmetrische Impulse. Bei ungünstigem
Umpolfehler können dann krasse Übersteuerungen auftreten.
Analyse der Aussteuerungswerte
über Band
In diesem Praxistest steuert man den Duo-Burst bis 0 dB Anzeige
oder Ansprache einer sonstigen Anzeige (z. B. LED-Leuchte) nach
Angabe des Herstellers aus. Aufnahme und Messung erfolgen dann
bei dieser Aussteuerung, jedoch mit dem Einfach-Burst. Der Wiedergabepegel
wird im Aussteuerungsdiagramm eingetragen. Er soll nicht über
dem für k3 = 3% liegen, da andernfalls in der Praxis Verzerrungen
hörbar sind. Zudem wird der Obertongehalt des Burst bei
Wiedergabe mit dem bekannten Original vor der Aufnahme verglichen.
Bei einer guten Aufnahme darf sich natürlich der Obertongehalt
nicht verändern.
Aber die Musik?
Die Musik kommt in unserem Hörtest zur Geltung. Auch ein
Duo-Burst kann sie (glücklicherweise!) nicht ersetzen.
Da wir aber über unsere Ohren nicht messen können
und kaum quantifizierbare und genau reproduzierbare Urteile
fällen können, hilft der Duo-Burst uns entscheidend
weiter, insbesondere beim Vergleich verschiedener Geräte
über größere Zeiträume. Immerhin erfüllt
der Duo-Burst drei wichtige Eigenschaften der Musik: 1. Wie
der musikalische Klang ist er von kurzer Dauer. 2. Während
seiner Dauer weist er eine wechselnde Impulsform auf. 3. Er
umfaßt ein breites Grund- und Obertonspektrum, und zwar
insgesamt von 63 Hz (Kontra-H) bis an die obere Hörgrenze.
(Punkt 1 ist übrigens der Grund, daß wir unsere frühere
200-Hz- und 2-kHz-Burst-Meß-methode durch den neuen Duo-Burst
abgelöst haben.)
Obertongehalt und Frequenzgang
prinzipiell dasselbe?
Verändert man den Höhenfrequenzgang, so verändert
man auch zwangsläufig das Obertonspektrum. Es handelt sich
also um die gleiche Wirkung und damit um den gleichen Höreindruck.
Um keine Verwirrung zu stiften und die Ursachen klar zu unterscheiden,
wählten wir aber verschiedene Bezeichnungen. Der Frequenzgang
wird nach DIN bei Bandmagnetisierungen bestimmt, die einer mittellauten
Wiedergabe entsprechen. Wir suchten nun eine Größe,
die bei praxisnaher Vollaussteuerung (also laut) die zusätzliche
(!) Frequenzgangänderung angibt. Dies nannten wir "Verminderung
des Obertongehaltes bei Vollaussteuerung". Bei unserer
Auswertung wird der übliche Frequenzgangfehler eliminiert
und nur die aussteuerungsabhängige Verschlechterung des
Frequenzganges angegeben. Der Obertongehalt bewertet den Bereich
von 7,5 kHz bis 17 kHz (-3 dB), der Schwerpunkt der Bewertung
liegt bei 11 kHz (siehe Bild 6). |
|
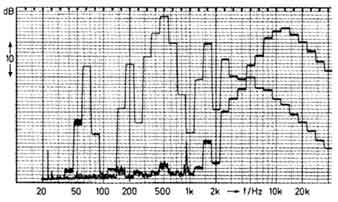 |
6 Spektralanalyse
des Einfach-Burst in Terzschritten. Die deutlichen Anteile der
500-Hz-Grundfrequenz sowie der ungeraden Harmonischen bei 1,5
kHz und 2,5 kHz sind zu erkennen, ebenso die Anteile der Burst-Wiederholfrequenz
von 500/8 Hz = 63 Hz sowie deren ungeraden Harmonischen bei
200 Hz und 315 Hz. Zusätzlich ist der Obertongehalt bei
Bewertung über unser Meßfilter dargestellt. Er umfaßt
im wesentlichen die oberste Oktave des Hörbereichs |
Hierzu wurde ein besonderes Filter erstellt. Wird
in einem Gerät die Bandbreite auf maximal 16 kHz begrenzt
(UKW-Übertragung, Tonbandgeräte mit MPX-19-kHz-Filter),
kann immer noch eine sehr gute Bewertung (9 Punkte) erreicht
werden. Dies entspricht auch unserer Hörerfahrung. Die
letzte bleibende Qualitätsstufe zu 10 Punkten ist allerdings
für sehr geübte Ohren noch feststellbar. (Bei unserer
früheren 2-kHz-Burst-Methode wurde die Obertongehaltverminderung
geometrisch aus der Steilheit der Impulsflanke errechnet. Die
Klangqualität wurde durch Angabe der bei Vollaussteuerung
gegebenen oberen Eckfrequenz (entsprechend -3 dB) bestimmt.
Eine frühere Angabe 10 kHz entspricht demnach ungefähr
der neueren Bewertung mit 7 Punkten.)
MPX-19-kHz-Filter
Allen unseren Lesern sei angeraten, bei 9,5 cm/s und noch geringerer
Bandgeschwindigkeit bei hochtonreichen Aufnahmen das MPX-Filter
einzuschalten (zumal bei Dolby-, dbx-, High-Com-Betrieb). Die
Absicht, Töne oberhalb 15 kHz aufzeichnen zu wollen, die
dann - auch wenn sie nur mittellaut sind -doch nicht sauber
gespeichert werden, wirkt sich negativ auf den Frequenzbereich
bis herab zu 5 kHz aus. Dieser "tiefere" Hochtonbereich
wird besser gespeichert, wenn das Band (und auch das Kompandersystem)
nicht mit unnötig hohen Frequenzen überlastet wird.
Es stellen sich hier ähnliche Effekte wie bei Transientenverzerrungen
ein, die ja derzeit in aller Munde sind.
Aussteuerungsgrenzwerte
Aus der Gesamtheit der ermittelten Daten bestimmen wir
Aussteuerungsgrenzwerte, die für eine weitgehend übersteuerungsfreie
bzw. verzerrungsfreie Aufnahme gelten. Je nach persönlichen
Wünschen kann natürlich bei störendem Rauschen
von diesen Werten auch nach oben hin abgewichen werden. Rauschfreiheit
und Verzerrungsarmut einer Aufnahme sind immer Gegenstand eines
Kompromisses.
Merksatz für Händler und Werbeleute
Nicht jedes Aussteuerungsinstrument ist ein träge ansprechendes
VU- Meter. Nicht jeder optische Indikator (Leuchtdioden-, Flüssigkristall-
oder Fluoreszenzanzeige) ist ein trägheitslos arbeitendes
Spitzenwertmeter. |
|
a. k.
aus: HiFi Stereophonie Mai 1979
Herzlichen Dank an die Motorpresse
Stuttgart für die Erlaubnis, diesen Artikel hier zu
veröffentlichen. |
|
|