|
|
| HiFi Stereophonie
1977: |
|
| 100 Jahre Schallaufnahme |
|
| Das Jahr 1977 steht im
Zeichen der Jahrhundertfeier für den Phonographen, der
1877 von seinem Erfinder Thomas Alva Edison in die Welt gesetzt
worden war. Für die Menschheit brach damit ein neues Zeitalter
an, denn was der Lügenbaron von Münchhausen mit eingefrorenen
Klängen in seinem Posthorn bis dato als brillante Flunkerei
aufgetischt hatte, war nun Wirklichkeit geworden. Edisons Sprechmaschine
war geeignet, Schallschwingungen jeglicher Art aufzubewahren.
Es begann die Geschichte der Schallaufnahmetechnik, die zu einem
der schillerndsten Industriezweige führen sollte. Über
den Phonographen und zur Erfindung der Schallplatte ist in diesem
Jubeljahr viel geschrieben worden. Die nachfolgenden Entwicklungen,
die schließlich zur Elektroakustik, zur Rundfunktechnik
und anderen Fachgebieten geführt haben, blieben weitgehend
unberücksichtigt. In der hier beginnenden Serie soll die
Geschichte einiger elektroakustischer Geräte, wie die des
Magnetophons und des Studiomikrophons, behandelt werden, wobei
allerdings kein Anspruch auf Vollständigkeit erhoben werden
kann. |
|
1. Entwicklung desTonbandgerätes
Am 12. August jährte sich zum hundertsten Male der Tag,
an dem es erstmals gelang, Schallschwingungen auf einem walzenförmigen
Tonträger zu konservieren. Dieses Kunststück brachte
der geniale Erfinder Thomas Alva Edison (1847-1931) fertig,
der sich damals ausgiebigen Studien der Akustik gewidmet hatte.
Die Sprechmaschine, von ihm "Phonograph" genannt,
brachte ihrem Erfinder in der alten und neuen Welt einen Achtungserfolg
ein, mehr aber auch nicht. Ähnlich erging es dem Deutsch-Amerikaner
Emil Berliner (1851-1929), der ein Jahrzehnt später das
"Grammophon" kreierte, einen Apparat, bei dem die
Schallschwingungen in runde Scheiben eingraviert wurden. Berliner
konnte jedoch in den folgenden Jahren sein Verfahren - wozu
auch eine rationelle Vervielfältigungstechnik seiner Grammophonplatten
zu rechnen ist - so weit verbessern, daß es sehr bald
in kommerzieller Hinsicht interessant wurde.
Es ist weithin unbekannt geblieben, daß das heute so populäre
magnetische Schallspeicherverfahren fast ebenso alt ist wie
Schallplatte und Phonographenwalze. Erste Hinweise findet man
bereits in der amerikanischen Zeitschrift "The Electrical
World" aus dem Jahre 1888, in der ein gewisser Oberlin
Smith theoretische Überlegungen anstellte [1], Der experimentelle
Nachweis mit einem "tönenden Draht" stammte von
Valdemar Poulsen (1869-1942), einem jungen Techniker der Kopenhagener
Telegraphen-Gesellschaft, der heute allgemein als Vater der
magnetischen Aufzeichnung gilt (Bild 1). |
|
 |
1 Valdemar Poulsen
(1869-1942), der Erfinder der magnetischen Schallaufzeichnung |
Er wies zunächst an einer 1,50 Meter langen
gespannten Klaviersaite nach, daß man diese mit einem
daran entlanggeführten Elektromagneten magnetisch "beschriften"
kann, wenn der Magnet mit einem betönten Mikrophon verbunden
wird. Diese Schallschrift konnte mit einem Telefonhörer
anstelle des Mikrophons wieder hörbar gemacht werden. Eine
praktikable Ausführung entstand im Jahre 1898. Hierbei
führte Poulsen einen Elektromagneten parallel zur Achse
einer mit einem langen Draht gewindeartig bespulten Walze mit,
wobei die Pole des Magneten die einzelnen Drahtwindungen umfaßten
(Bild 2). Der Erfinder beschrieb sein Verfahren in den Annalen
der Physik im Jahre 1900 [2]; er ging auch auf die Klangqualität
ein und vermerkte: "... hat die wiedergegebene Rede eine
besondere Reinheit und Klarheit ohne lästigen Beilaut.
Die... Apparate geben nicht nur, was gesprochen und gesungen
wird, außerordentlich korrekt wieder, sondern was auch
in das Mikrophon geflüstert wird; selbst der schwache Laut
des Atemzuges kann wiedergegeben werden. "
Valdemar Poulsen nannte seine Erfindung "Telegraphon".
Die eigentümliche Bezeichnung rührt wohl daher, weil
er Anwendungen im Fernsprechbereich für möglich hielt.
Das Telegraphon wurde 1900 auf der Pariser Weltausstellung gezeigt,
wo es große Bewunderung erregte und den Grand Prix erhielt.
Dort wurde es auch dem greisen Kaiser Franz-Joseph von Österreich
vorgeführt, der sich auf einer erhalten gebliebenen Aufnahme
sehr lobend über den Apparat ausgesprochen hat [3].
|
|
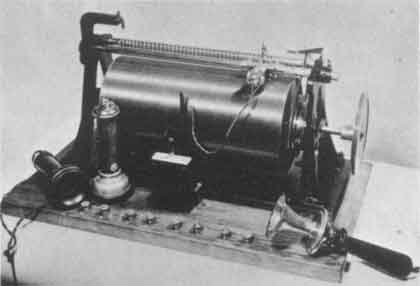 |
2 Das erste magnetische
Schallaufzeichnungsgerät, das Telegraphon aus dem Jahre
1898 von Valdemar Poulsen. Rechts im Vordergrund das Mikrophon
zum Besprechen, links zwei der damals üblichen Telefonhörer
zum Abhören der Aufnahme |
In den folgenden Jahren wurden noch andere Ausführungen
gebaut und erprobt (auch in Deutschland von Mix und Genest),
wobei man den Draht - wie beim heutigen Prinzip - von einer
Spule auf eine zweite wickelte. Außerdem experimentierte
Poulsen mit 3 mm breiten und 0,05 mm dicken Stahlbändern
und wies auf den dabei möglichen Kopiereffekt hin. Die
Bandgeschwindigkeit betrug etwa 2 Meter pro Sekunde. Zum Teil
waren diese Entwicklungen als Diktiergeräte konzipiert,
die bereits mit einer Fernbedienung ausgerüstet waren (Patent
1906 [4]). Ein solcher Apparat wurde während des Zweiten
Weltkrieges von den damals recht ahnungslosen Amerikanern für
militärische Zwecke nachgebaut, zu einer Zeit also, als
in Deutschland das AEG-Magnetophon mit seiner heute gültigen
Technik bereits vorhanden war. Jedoch, wir wollen dem Gang der
Entwicklung nicht vorgreifen.
Das Telegraphon verschwand nämlich für fast zwanzig
Jahre in der Versenkung, denn obwohl Poulsen von Anfang an sehr
richtig erkannt hatte [2], daß man mit Hilfe eines Gleichstromanteils
einen günstigen Arbeitspunkt auf der Magnetisierungskennlinie
benötigte, fehlten der damaligen Technik noch jegliche
elektronische Hilfsmittel und ausreichende Fertigungstechnologien
für die Herstellung der Köpfe und des Antriebs. Sprache
und Musik klangen keineswegs in "besonderer Reinheit und
Klarheit", wie Poulsen es im ersten Überschwang und
wohl auch im Vergleich zur damals noch recht primitiven Nadeltontechnik
Emil Berliners und Edisons gerühmt hatte. Deutlich waren
Verzerrungen hörbar und außerdem ein Rauschen, das,
wie wir heute wissen, von der Gleichfeldmagnetisierung verursacht
wurde. Der Däne widmete sich neuen, aktuelleren Problemen;
er beschäftigte sich mit der Erzeugung ungedämpfter
elektrischer Schwingungen und überließ es anderen,
die Magnettontechnik voranzutreiben.
Nach dem Ersten Weltkrieg griff man an mehreren Orten das Telegraphon-Prinzip
wieder auf. Man sah darin eine Möglichkeit, den stummen
Kinofilm zu tönendem Leben zu erwecken, was sich allerdings
als nicht zukunftsträchtig erwies. In diesem Zusammenhang
müssen die Namen von Curt Stille, Joseph O'Neill und nicht
zuletzt von Carlson und Carpenter erwähnt werden, die bereits
1927 in Amerika die Hochfrequenz-Vormagnetisierung erprobten.
Der deutsche Physiker Stille, der 1923 das elektromagnetische
Plattenschneideverfahren in Europa eingeführt hatte, beschäftigte
sich besonders intensiv mit der Magnettontechnik. Seine Entwicklungsergebnisse
gingen 1930 an Blattner und später an die englische Marconi-Wireless
Telegraph Co. Ltd. über. Diese Firma fertigte für
die BBC einige Stahlbandmaschinen, die einen Frequenzbereich
von 100 bis 5000 Hz bei einer Laufgeschwindigkeit von 1,50 Meter
pro Sekunde aufwiesen. In Deutschland wurde die Stahltonmaschine
von C. Lorenz bekannt, die ebenfalls im Rundfunk eingesetzt
wurde. Die Bänder waren 3 mm breit, die Aufnahmedauer betrug
immerhin 30 Minuten. Leider waren die Stahlbänder recht
unhandlich. Bandrisse mußten mit dem Schweißbrenner
behoben werden, was an der Verbindungsstelle unliebsame Nebengeräusche
hinterließ.
Der Dresdener Ingenieur Fritz Pfleumer arbeitete fast gleichzeitig
mit Papierbändern, die er mit feinen Stahlspänen beschichtet
hatte. Diese Methode erwies sich als so aussichtsreich, daß
sich die Allgemeine Elektrizitäts-Gesellschaft (AEG) dafür
zu interessieren begann. Mittlerweile war auch die Elektronik
so weit gediehen, daß für die notwendige Spannungsverstärkung
keine Probleme mehr bestanden. Zudem verfügte man jetzt
über halbwegs brauchbare Mikrophone und Lautsprecher, denn
inzwischen war der Rundfunk und der Tonfilm geboren worden.
Sie beide haben eine zielstrebige Verbesserung der bestehenden
Schallwandler ausgelöst. Die Badischen Anilin- und Soda-Fabriken
wurden beauftragt, eine Kunststoff-Folie zu entwickeln und herzustellen,
die anstelle des empfindlichen Pfleumerschen Papierträgers
verwendet werden konnte. Die Ludwigshafener Firma im damaligen
IG-Farben-Konzern fand eine solche Folie auf der Basis der Azetylzellulose
und sorgte im übrigen für die gleichmäßige
Beschichtung, wobei man zu dem besonders vorteilhaften braunen
Gammaeisenoxid übergegangen war. 1934 konnten die ersten
50000 Meter Tonband ausgeliefert werden.
Bei der AEG war inzwischen der Prototyp eines Magnetbandgerätes
herangereift, das unter der Bezeichnung "Ferroton"
auf der Funkausstellung gezeigt werden sollte. Wegen technischer
Schwierigkeiten vertagte man die Demonstration um ein Jahr.
1935 schließlich präsentierte die AEG unter dem neuen,
noch heute firmengeschützten Namen "Magnetophon"
ihr erstes Magnetbandgerät mit der Typenbezeichnung K 1,
das mit einer Bandgeschwindigkeit von 1 Meter pro Sekunde betrieben
wurde (Bild 3 und 4). |
|
 |
3 AEG-Magnetophon
K 1 mit drei Tonköpfen, drei Motoren und Drucktastensteuerung,
das 1935 erstmals auf der Berliner Funkausstellung vorgestellt
wurde |
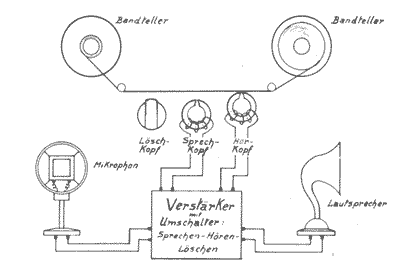 |
4 Zeitgenössisches
Prinzipschaltbild des Magnetophons |
Die Spieldauer eines Tausend-Meter-Bandwickels
betrug fast 17 Minuten, der Frequenzgang verlief von 50 bis
6000 Hz linear dank neuartiger Ringköpfe von Schüller.
- Bereits damals wurde nicht nur die Breite des Tonbandes mit
6,35 mm festgelegt (nach dem Krieg geringfügig auf 6,25
mm reduziert), sondern auch der Kopfträger in der Weise
angeordnet, daß die Magnetschicht nach außen zeigen
muß. Die "deutsche Schichtlage" hat sich heute
nur noch bei den einheimischen Laufwerken der Rundfunk-und Studiotechnik
gehalten. Alle ausländischen Maschinen sowie die Heimgeräte
(auch die deutschen) arbeiten mit der "internationalen
Schichtlage", d. h. also Schicht nach innen. Ein drittes
Merkmal, das noch heute im Studiobereich vorherrschend ist,
geht ebenfalls auf das alte K-1-Konzept zurück: Schon damals
wurden freitragende Bandwickel verwendet. Das Band wird hierbei
nicht auf Flanschspulen, sondern auf scheibenförmige Wickelkerne
gespult. Das ermöglicht ein schnelles Handhaben der Bänder,
z. B. beim Einfädeln, Schneiden und Kleben (Bild 5).
|
|
 |
5 Cut-Arbeiten
am AEG-Studio-Tonbandkoffer B 2 im Südwestfunk 1948. Man
beachte die dazu notwendigen Utensilien im Vordergrund: Taschenmesser
und Fläschchen mit dem flüssigen Klebstoff |
Im folgenden Jahr, am 19. November 1936, wurde
im Ludwigshafener Feierabendhaus zum erstenmal ein öffentliches
Konzert auf Band genommen, in dem die Londoner Philharmoniker
unter Sir Thomas Beecham spielten. Wenn man die erhalten gebliebenen
Aufnahmen heute anhört, wird einem bewußt, mit welchen
Mängeln die damalige Magnettontechnik noch behaftet war,
wobei allerdings auch die jahrzehntelange Alterung der noch
keineswegs optimalen Tonbänder zu berücksichtigen
ist [6]. Der Arbeitspunkt wurde noch wie bei Poulsens Telegraphon
mit einem magnetischen Gleichfeld fixiert. Auch der Löschvorgang
geschah auf diese Weise, wodurch ein hoher Rauschpegel hervorgerufen
wurde.
Trotz aller Schwierigkeiten interessierte sich aus naheliegenden
Gründen der Rundfunk für das Magnetophon. Die Reichs-Rundfunk-Gesellschaft
(RRG) verwendete für ihre Schallaufnahme Wachs- und Decelithplatten,
die wegen der starken Abnutzung nur wenige Male abgespielt werden
durften [7]. Für Hörspielaufnahmen hatte sich das
vom Tonfilm bekannte Lichttonverfahren eingebürgert [8],
das wegen der Klangqualität ebenfalls unbefriedigend war.
In den Jahren 1937/38 wurde das Magnetband für Reportagen
etc. eingeführt; hierbei bewährte sich die Möglichkeit,
uninteressante Passagen aus dem Band herausschneiden zu können.
Zudem konnte die Aufnahme sofort nach der Aufzeichnung wiedergegeben
werden; bereits bespielte Bäner ließen sich für
Neuaufnahmen wieder verwenden. Für Musikeinspielungen reichte
die Qualität allerdings noch nicht aus; hier blieb man
bei Live-Übertragungen oder beim Plattenschnitt, der jedoch
wegen der begrenzten Spieldauer von 4,5 Sekunden auch problematisch
war. Die Schallplattenindustrie zeigte sich bis Ende des letzten
Krieges gänzlich uninteressiert am magnetischen Aufzeichnungsverfahren.
Auch hier hielt man an der bisherigen Technik mit dem direkten
Schnitt der Matrize fest. Das Magnetophon ließ sich also
nur begrenzt einsetzen. Um so mehr experimentierte man in den
Labors der Industrie und des Rundfunks damit. Schon damals versuchte
man sich z. B. mit stereophonen Aufzeichnungen. Mehr aus Zufall
wurde im Jahre 1940 bei all diesen Experimenten durch J. von
Braunmühl und W. Weber bei der RRG eine neue Art der Vormagnetisierung
entdeckt, als ein Aufnahmeverstärker ungewollt auf einer
hohen Frequenz zu schwingen begann. Das Ergebnis offenbarte
sich in einer nahezu rausch- und verzerrungsfreien Aufnahme.
Nach Erforschung und Optimierung dieses Effektes wurde die sogenannte
Hochfrequenz-Vormagnetisierung eingeführt, die sich bis
zum heutigen Tag bestens bewährt hat [9]. Auch das Löschen
der Bänder geschieht seitdem mit einem hochfrequenten Magnetfeld,
bei dem die magnetisch aktive Schicht des Tonbandes in einen
quasi- jungfräulichen Zustand zurückgeführt wird.
Die Bandgeschwindigkeit konnte auf 76 cm pro Sekunde gesenkt
werden.
Diese bahnbrechende Entwicklung, die das Magnettongerät
erfahren hatte, ging in dem damals von aller Welt isolierten
Deutschen Reich nahezu unbemerkt vor sich. Die Alliierten entdeckten
bei der Besetzung von Radio Luxemburg drei der damaligen Magnetophone
und wunderten sich von Stund an nicht mehr über die liveartige
Tonqualität der Hitler-Reden, die fast den ganzen Tag in
den Äther geschickt worden waren.
Im weiteren Verlauf, vor allem in der Zeit nach dem Zweiten
Weltkrieg, eroberte sich das Tonband rasch die neuerstandenen
Funkhäuser und Schallplattenstudios (Bild 5). Natürlich
zeigte auch das Ausland reges Interesse. Es dauerte nicht lange,
da wurden in der Schweiz, in Dänemark, dem Ursprungsland
der Magnettontechnik, und nicht zuletzt in den Vereinigten Staaten
ähnliche Magnetbandgeräte hergestellt. Auch die Tonbandfertigung
blieb nicht allein auf die Ludwigshafener BASF beschränkt.
Der Siegeszug dieses bequemen Speicherverfahrens war unaufhaltsam.
Mitte der fünfziger Jahre konnte die Bandgeschwindigkeit
unter Beibehaltung der Tonqualität halbiert werden; seitdem
gilt 38 cm pro Sekunde als Studiostandard.
Nach der Währungsreform war man fertigungstechnisch so
weit vorangeschritten, daß die Industrie auch für
den Hausgebrauch leichte Tonbandgeräte anbieten konnte.
Sie wurden in Halbspurtechnik mit einer Bandgeschwindigkeit
von 19 cm pro Sekunde betrieben. Die BASF entwickelte dazu ein
speziell es Tonband, das 1950 auf der Düsseldorfer Funkausstellung
gezeigt wurde. Die weitere Entwicklung der Heimgerätetechnik
ist bekannt, sie sei hier in einigen Stichworten markiert:
1952 Bandgeschwindigkeit 9,5 cm/s
1953 erstes Langspielband (35 µm)
1954 Bandgeschwindigkeit 4,75 cm/s
1957 Bandgeschwindigkeit 2,38 cm/s
1958 erstes Doppelspielband (26 µm)
1959 Viertelspurtechnik, Stereo-Betrieb 1961 Dreifachspielband
(18 µm)
1963 Kompaktkassette
1965 Low-Noise-Bänder
1971 Chromdioxidbänder
1975 Ferrochrombänder
In gerätetechnischer Hinsicht konnten in den vergangenen
vier Jahrzehnten seit Bestehen des K-1-Magnetophons mancherlei
Fortschritte verzeichnet werden. Viele Probleme, vor allem die
des konstanten Bandtransports, sind gelöst worden. Seit
Beginn der sechziger Jahre hat sich die Transistorisierung auch
in diesem Bereich durchgesetzt, und in jüngster Zeit gewinnt
die elektronische Laufwerksteuerung immer mehr an Boden. In
Japan wurden in den letzten Jahren Wege gezeigt, wie man mit
Hilfe einer Analog-Digitalwandlung die Dynamik und das Impulsverhalten
bei der Bandaufzeichnung hoch wesentlich steigern kann [11].
Schließlich hat sich das Magnetband auch in anderen Anwendungsgebieten
verdient gemacht, wenn wir an die Aufzeichnung von Video-Signalen
(MAZ) und die Datenspeicherung in der Computertechnik denken.
Die Magnetbandaufzeichnung hat - verglichen mit anderen technischen
Errungenschaften - eine recht lange Entwicklungszeit hinter
sich gebracht. Nichtsdestoweniger hat sie mit dazu beigetragen,
unsere Umwelteinflüsse zu verändern und unser Leben
in akustischer und visueller Hinsicht zu bereichern, von der
revolutionierenden Umwälzung, die durch die EDV über
uns hereingebrochen ist, ganz zu schweigen. Valdemar Poulsen
selbst, der ja erst 1942 starb, hat dies nicht absehen können,
als er seine Experimente an einer harmlosen Klaviersaite vor
fast achtzig Jahren vornahm.
Claus Römer |
|
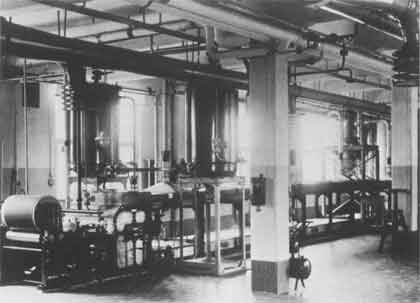 |
6 Tonbandfabrik
1938. Eine kombinierte Folienzieh- und Tonband-Gießmaschine,
gebaut von der Firma Koebig in Radebeul bei Dresden |
Quellenhinweise
| [1] |
Oberlin Smith: Some Possible Forms of
Phonograph, in: The Electrical World (1888) |
| [2] |
V. Poulsen: Das Telegraphon. Annalen Phys.
Band 3, S. 754 (1900) |
| [3] |
Tonaufnahme von Kaiser Franz-Joseph (1900).
Technisches Museum für Industrie und Gewerbe, Wien |
| [4] |
AES-Print zur Ausstellung der 47. Convention
in Kopenhagen (1974) |
| [5] |
v. Braunmühl und Weber: Einführung
in die angewandte Akustik. Verlag S. Hirzel (1936) |
| [6] |
Tonaufnahme des Symphoniekonzertes in
Ludwigshafen (1936). BASF, Ludwigshafen |
| [7] |
Schadwinkel: 50 Jahre Hörrundfunk.
Rundfunktechnische Mitteilungen 1, S. 31 (1974) |
| [8] |
Goebel: Der Deutsche Rundfunk. Archiv
für das Post- und Fernmeldewesen (dort weitere Literaturhinweise)
Nr. 6, S. 353 (1950) |
| [9] |
v. Braunmühl und Weber: DRP 743 411
vom 28. 7. 1940 |
| [10] |
Snel:Magnetische Tonaufzeichnung. Philips
Technische Bibliothek (1959) |
| [11] |
Römer: PCM-Platten, ein Fortschritt?
HiFi-Stereophonie Nr. 7, S. 804 (1977) |
|
|
| aus: HiFi Stereophonie 11/1977
Seite 1544 ff. |
|
|